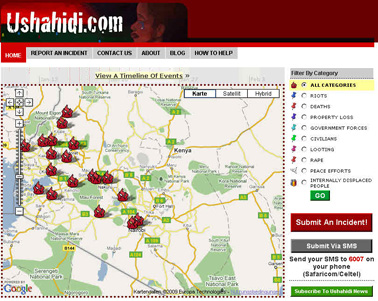In der 12. Runde der NPO-Blogparade fragt Katrin Kiefer von netzwerkPR: “Welche Schritte müssen NPOs intern vollziehen, um Social Media erfolgreich einsetzen zu können?”
In der 12. Runde der NPO-Blogparade fragt Katrin Kiefer von netzwerkPR: “Welche Schritte müssen NPOs intern vollziehen, um Social Media erfolgreich einsetzen zu können?”
Social Media ermöglichen den Dialog und die Vernetzung mit den Stakeholdern. Aber wie Katrin Kiefer richtig feststellt, werden diese Potentiale des Mitmach-Internets von vielen Nonprofits noch nicht ausgeschöpft. Häufig folgen die Web 2.0-Aktivitäten von gemeinnützigen Organisationen der Logik des Monologs: Nonprofits treten als Sender auf und verbreiten ihre Botschaft. Wie der Empfänger darauf reagiert, interessiert nicht. Insbesondere an vielen Twitteraccounts von gemeinnützigen Trägern wird diese monologische Herangehensweise an Social Media sichtbar.
Der Wille, sich mit anderen Organisationen und Individuen über das Internet oder in der realen Welt zu vernetzen, entsteht dann, wenn
- eine Organisation das Ausmaß ihrer eigenen Ressourcenabhängigkeit kennt
- sie ihre Ressourcenquellen ausweiten und diversifizieren möchte
- und sie den internen und externen Akteuren zutraut, als potentielle Ressourcenquellen in Frage zu kommen. Oder anders formuliert: wenn Stakeholder nicht als bedrohlich oder vernachlässigbar wahrgenommen werden, sondern als Chance.
Nun kennen gemeinnützige Organisationen ihre Abhängigkeit von monetären Ressourcen sehr gut – die Klagen über ihre finanzielle Notlage kann man beinahe täglich lesen oder hören. Ganz anders sieht die Sache jedoch aus, wenn es um nicht-monetäre Ressourcen für den Nonprofit-Sektor geht. Wie sehr vermissen gemeinnützige Organisationen Ideen, empirisches Wissen und Vorschläge aus der Bürgerschaft? Wie sehr wünschen sie sich Stakeholder, die sich aktiv einbringen und partizipieren? Der Wunsch nach Vernetzung und nach einem Ressourcenaustausch mit anderen entsteht erst, wenn man als Organisation die eigenen Schwächen, den eigenen Mangel und die eigenen Grenzen kennt, – und zwar auch jene, die über den finanziellen Bereich hinausgehen.
Für viele Nonprofits ist in erster Linie der eigene Finanzbedarf die wichtigste Ressourcenabhängigkeit, die gesehen wird. Und der Staat ist für die Träger sozialer Dienste die wichtigste Ressourcenquelle, – rund zwei Drittel ihrer Einnahmen kommen von hier, nur etwa 4% von privater Seite über Spenden.
Die Frage ist, ob gemeinnützige Organisationen eine Ausweitung und Diversifizierung ihrer Ressourcenquellen ernsthaft anstreben oder ob man sich im bestehenden System nicht gut eingerichtet hat? Zwar wird der Staat seine prominente Rolle als Finanzier im Sozialbereich nie verlieren können und dürfen, aber mehr Ressourcen aus dem gesellschaftlichen Sektor wären für gemeinnützige Organisationen sicher nützlich.
Ob man sich allerdings als Organisation mit bestehenden und neuen Stakeholdern enger vernetzt und den Ressourcenaustausch intensiviert, hängt auch damit zusammen, ob man den Menschen und Einrichtungen, die einen umgeben, überhaupt zutraut, eine relevante Ressourcenquelle zu sein – verglichen mit so potenten Akteuren wie dem Staat. Was kann eine gemeinnützige Organisation von ihren Ehrenamtlichen, von Klienten, Angehörigen, von Bürgern und von den anderen Nonprofits ihrer Gemeinde erwarten? Nur wenn eine Organisation von der Bedeutung der Ressourcen, die ihre Stakeholder bieten, überzeugt ist und sie wertschätzt, wird sie an einem engeren Austausch und an einer engeren Vernetzung interessiert sein.
Um auf die Frage von Katrin Kiefer nach den internen Schritten zurückzukommen, die NPOs unternehmen müssen, um Social Media erfolgreich einsetzen zu können:
Es ist sinnvoll, wenn Nonprofits ein internes Ressourcenassessment vornehmen, um die eigene Ressourcenabhängigkeit und die eigenen Ressourcenquellen zu analysieren. Die Abhängigkeit von wenigen Ressourcengebern deutet auf eine mangelhafte Vernetzung einer Organisation hin bzw. auf Defizite im Bereich soziales Kapital. Die Analyse der eigenen Abhängigkeit kann die Triebfeder für ein internes Programm sein, das auf den verstärkten Netzwerkaufbau – online und offline – zielt.
Auf jeden Fall ist es sinnvoller, eine interne Social Media-Strategie an den organisationalen Bedürfnissen festzumachen, als an einem kulturellen Wandel der Organisation hin zu mehr Offenheit und Dialog. Ein kultureller Wandel braucht Zeit. Und “welches Unternehmen ändert seine Unternehmenskultur, um dann später mal twittern zu können? Der Ansatz, auf die passende Unternehmenskultur zu warten, ist (..) unrealistisch”, wie mein Blogger-Kollege Henner-Fehr schreibt. Realistischer ist, dass die organisationale Ressourcenabhängigkeit einen adäquaten Social Media-Einsatz forciert.
Nun kann man einwenden, dass ein internes Ressourcenassessment ein hoher Aufwand ist, wenn es doch nur darum geht, einen Twitteraccount oder eine Facebook-Präsenz einzurichten. Aber wenn in einer Organisation der Social Media-Einsatz nicht organisch gewachsen ist – und das ist in den meisten etablierten NPOs nicht der Fall – dann sollte man sich dem Thema ‘Internet’ strategisch nähern. Und das eigene Social Media-Engagement auf ein gutes inhaltliches Fundament stellen. Nur auf dieser Basis wird das Engagement dauerhaft sein und den eigenen Bedürfnissen, den Bedürfnissen der Stakeholder und des Mediums gerecht werden können.